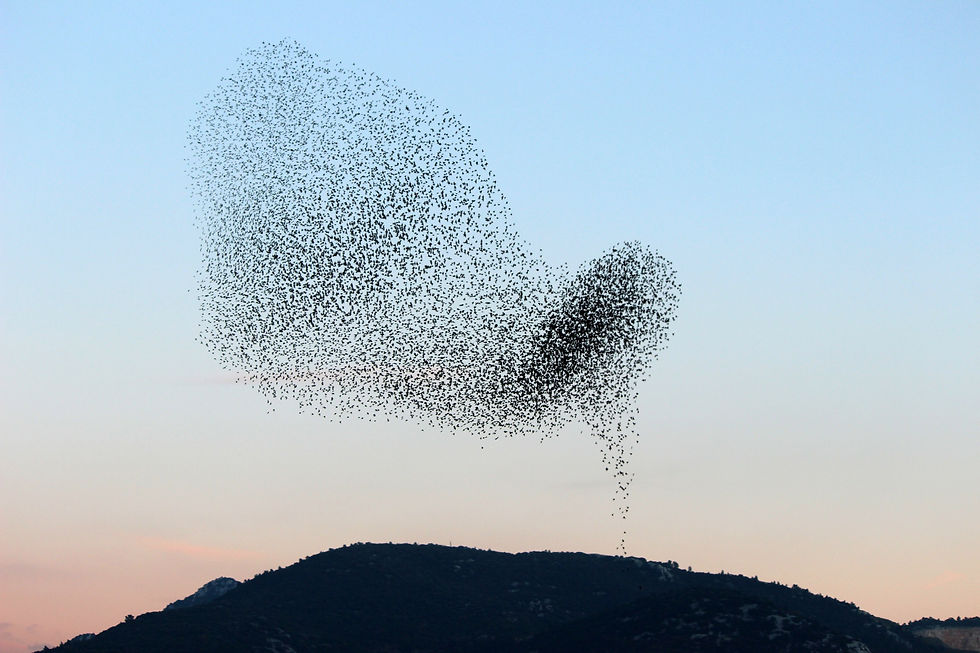"Houston, we've had a problem..."
- Fred Malich

- 3. Nov. 2024
- 2 Min. Lesezeit

Mit diesem Satz begann am 13. April 1970 eine der spektakulärsten und letztlich glücklich verlaufenen Rettungsaktionen des 20. Jahrhunderts. Zwei Tage zuvor war das Raumschiff Apollo 13 mit der Crew Jim Lovell, Jack Swigert und Fred Haise planmäßig zum Mond gestartet. Bis zu dem Moment, als sich wie aus dem Nichts eine fatale Explosion ereignete, deutete nichts darauf hin, dass diese Mondmission ihr Ziel nicht erreichen würde. Grund genug hier nochmals kurz zu beleuchten, was die Kooperation zwischen den drei Crew-Mitgliedern und dem Bodenkontrollzentrum der NASA in Houston während der viertägigen Rettungsphase auszeichnete.
Rasche Bestandsaufnahme und nüchterne Einordnung
Die zwischen dem Bodenkontrollzentrum und der Crew gemeinsam vorgenommene Fehleranalyse ergab vergleichsweise schnell, dass zwei von drei Brennstoffzellen im Servicemodul explodiert waren und dabei beide Sauerstofftanks schwerwiegend beschädigt hatten. Damit war klar, dass es im Kommandomodul von Apollo 13 mehrere gravierende Probleme gab: zu wenig Sauerstoff, zu wenig Wasser und zu wenig Energie zur Triebwerkszündung, um nach einer Mondumrundung die Flugbahn zurück zur Erde einschlagen zu können. Zur Einordnung gehörte aber auch, den bedrohlichen Schaden zu relativieren. Dazu gehörten die Feststellungen, dass sich sowohl die Explosion in einer unkritischen Flugphase ereignet hatte als auch, dass das Landemodul mit seinem Triebwerk noch komplett in Takt war.
Generierung und Umsetzung von Optionen
In dieser Situation kam es darauf an, möglichst schnell auch unkonventionelle Ideen zu generieren, um zumindest Teilaspekte dieser Probleme zu entschärfen. Zu einem frühen Zeitpunkt wurde zwischen Bodenkontrollzentrum und Crew die Idee entwickelt, das Landemodul zum "Rettungsboot" umzufunktionieren. Energieabsenkende Maßnahmen an Bord, Anzapfen der Batterie des Landemoduls, Reduzierung des Wasserkonsums sowie die Berechnung neuer energiearmer Rückflugbahnen gehörten zu den weiteren realisierten Optionen.
Sprache
In den Protokollen des Sprechfunks unmittelbar vor der Explosion fällt auf, dass nicht nur technisch kommuniziert wurde. Gegenseitiges Anreden mit dem Vornamen, Lob für ausgeführte Aktionen oder ein simples "Thank you" für eine gegebene Antwort deuten darauf hin, dass trotz der technischen Aufgabenstellung die persönliche Beziehung regelmäßig mit gepflegt wurde. Dies war das Fundament für den offenen Austausch nachdem sich die Explosion ereignet hatte. Im weiteren Verlauf der Rettungsaktion wird diese persönliche Beziehung deutlich vertieft: "I want to say you guys are doing real good work." (Jack Swigert zum Bodenkontrollzentrum) und erlaubt am vorletzten Tag der Rettung sogar eine von Understatement geprägte neue Perspektive: "Well, I can't say that this week hasn't been filled with excitement." (James Lovell zum Bodenkontrollzentrum). Die passende Antwort des Bodenkontrollzentrums lässt nicht auf sich warten: "Well, James, if you can't take any better care of a spacecraft than that, we might not give you another one." Ironie kann bei stabilen Beziehungen eben auch ein die Kohäsion stärkendes sprachliches Mittel sein.