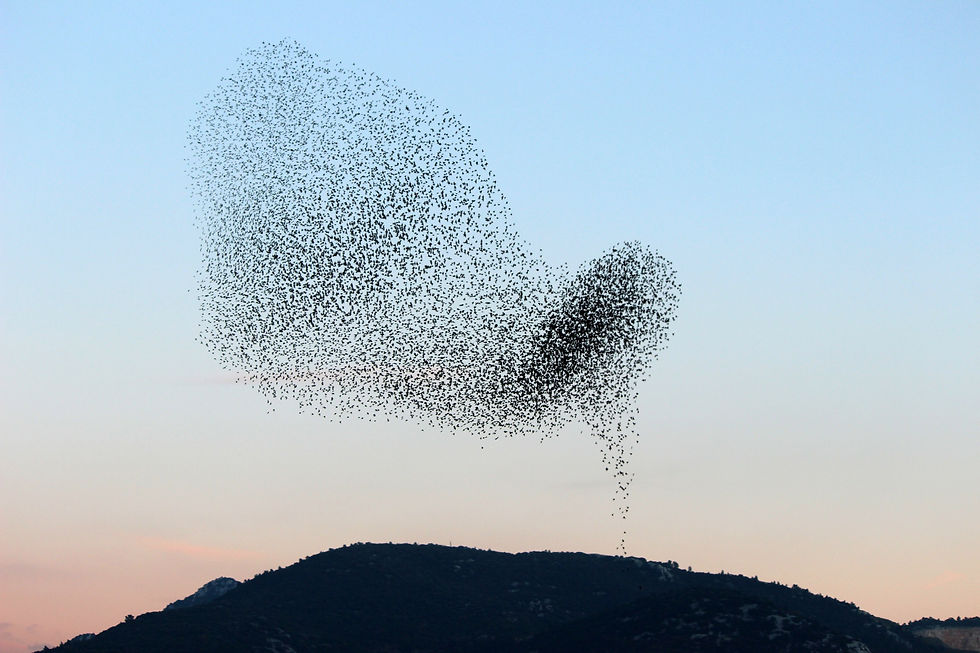Was ist eigentlich "Kognitive Dissonanz"?
- Fred Malich

- 2. Nov. 2024
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 13. Dez. 2024

Der US-Amerikaner Leon Festinger (1919-1989) entwickelte in den fünfziger Jahren eine Theorie, wonach Personen auch nach einer Entscheidung weitere neue und als relevant erachtete Informationen verarbeiten und bewerten. Ziel ist dabei, zu Aussagen über die getroffene Entscheidung zu gelangen. Solche Aussagen können bestätigend sein („Dann ist ja alles gut!“) oder die getroffene Entscheidung in Frage stellen („Das ist jetzt aber gar nicht gut.“).
Im ersten Fall werden die neuen Informationen als konsistent zur ursprünglichen Entscheidung angesehen: die neue Informationslage passt zur Ausgangsentscheidung; beide stehen miteinander im Gleichgewicht. Die Theorie der kognitiven Dissonanz wird deshalb auch zur Klasse der psychologischen Gleichgewichtstheorien gerechnet.
Im zweiten Fall steht die neue Information im Widerspruch zur zuvor getroffenen Entscheidung. Hier postuliert die Theorie für die betreffende Person einen unangenehmen motivationalen Zustand ("kognitive Dissonanz"). Zur Verbesserung dieser Situation streben Personen regelmäßig einen Spannungsabbau an. Dies kann geschehen, indem eigene Einstellungen oder eigenes Verhalten verändert werden oder auch indem eine Person eine grundsätzlich neue Sichtweise auf die Entscheidungssituation einnimmt. Jede dieser Maßnahmen ist geeignet, das Kooperationspotenzial einer Person zu erhöhen.
Festingers Modernität
Zusammen mit Kurt Lewin (1890-1947), der mit seiner Familie bereits 1933 vor den Nazis aus Deutschland in die USA floh, gilt Festinger als Begründer der modernen Sozialpsychologie. Seine Arbeiten gehen weit über die Theorie der kognitiven Dissonanz hinaus. In ähnlicher Weise fundamental ist seine Theorie sozialer Vergleichsprozesse. Trotzdem blieben Festingers Interessen nicht auf die Psychologie beschränkt. Im Alter von 60 Jahren wechselte er sein Aufgabenfeld komplett und widmete sich fortan archäologischen und geschichtlichen Aufgaben – auch dies ein Zeichen seiner Modernität.
Bedeutung
Die Arbeitsweise Festingers basierte stark auf selbst entwickelten psychologischen Experimenten und deren konsequente statistische Auswertung. Die Theorie der kognitiven Dissonanz führte mit dazu, dass das in der Psychologie bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts vorherrschende behavioristische Denken – also Handlungserklärungen auf Basis von Reiz-Reflex-Schemata, frei von Bewusstseinsprozessen – überwunden wurde. In der wissenschaftlichen Psychologie wird diese Wandlung seither als Kognitive Wende bezeichnet. Aktuell belegen knapp 65.000 Verweise auf wissenschaftliche Veröffentlichungen mit dem Stichwort cognitive dissonance die Wirkkraft dieser Theorie bis heute.